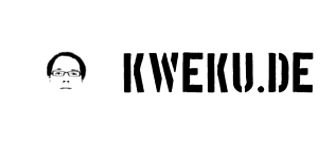Der »Stadtschreiber« David Wagner war letzte Woche zu Gast am Fachbereich Deutsche Sprache/Deutsche Philologie der Universität Turku (die Veranstaltung fand jedoch im Uni-Hauptgebäude statt, genauer im Hörsaal 2, der übrigens von einer Bank genamenssponsert wird). Er hat dort aus seinem Roman Vier Äpfel gelesen und sich der Diskussion mit Studierenden des Fachs Deutsch gestellt, die das Buch zuvor in einem Seminar besprochen hatten. Jetzt waren sie aneinandergereiht und mit ihren Exemplaren der Vier Äpfel in der Hand auf einem kleinen Podest versammelt, Wagner in ihrer Mitte. Er bemerkte sofort, dass ein Student keine gedruckte Ausgabe seines Romans, stattdessen einen E-Book-Reader, in den Händen hielt. Das verleitete ihn zu dem Hinweis, dass sich nach dem Absatz von 12000 Hardcover-Exemplaren gerade einmal vier elektronische Ausgaben verkauft hatten.
Wagner, der selbst unter anderem Literaturwissenschaft studiert hat, gestand gleich zu Beginn, dass er selbst nicht genau wisse, was man sich genau unter einem »Stadtschreiber« vorzustellen habe, jedenfalls handele es sich dabei um ein Projekt des Goethe-Instituts. Er sei zu Gast in Helsinki und solle nun ein wenig über seine Eindrücke bloggen. Untergebracht auf einem der Touristenmagnete der Hauptstadt, der Festungsinsel Suomenlinna, tut er genau das und berichtet über Sonderbar-Finnisches.
Doch zurück in die alte Hauptstadt, nach Turku. Vier Äpfel thematisiert die europäische Konsumkultur aus der Perspektive eines Protagonisten, den der Leser bei einem Einkauf im Supermarkt begleitet und der, von der ganz eigentümlichen Welt des Supermarktes angeregt, teilweise gar philosophische Betrachtungen über Konsum anstellt. Das Werk beginnt mit dem Eintritt des Protagonisten in diese sonderbare Sphäre und endet mit dem Verlassen des Supermarktes. Der Ich-Erzähler fühlt sich gefangen, nachdem er den Einkaufswagen gelöst und durch die orangefarbenen Plastikzungen geschoben hat und selbst durch das metallene Drehkreuz, das kein Zurück erlaubt, geschleust ist. Als er jedoch vier Äpfel abwiegt und feststellt, dass sie exakt 1000 Gramm wiegen, vermutet er eine gewisse Magie in diesem Ort.
Die Supermarktregale erlauben keine Lücke, statt dessen erzeugen sie eine Schlaraffenland-Atmosphäre, in der das Zuviel regiert: »So viel zu essen, und ich habe gar keinen Hunger, so viel zu trinken, und ich habe gar keinen Durst.«, lässt der Erzähler verlauten. Gleiches gilt etwa für Shampoos, »eigentlich will man sich nur die Haare waschen, aber da muss man von 120 Shampoos eines auswählen«, heißt es da. Dabei lässt Wagner seinen Entdecker deren Namen analysieren, die meist Begriffe wie health oder repair enthalten und der Protagonist bemerkt, dass die Form der Shampooflaschen sich genau dann ändert, wenn man sich gerade an ein Aussehen gewöhnt hat und in der Lage ist, die Stammsorte im Regal ausfindig zu machen. Das nimmt er zum Anlass, daraus Anmerkungen über die Kultur, in der so etwas stattfindet, als Ganzes abzuleiten.
Immer wieder wird der Gang durch den Supermarkt verwoben mit Erinnerungsfetzen, vor allem an eine ehemalige Liebhaberin der Hauptperson, die nur aus deren Retrospektive heraus konstruiert wird und daher kryptisch und schemenhaft bleibt, was sich auch an ihrem Namen äußert – »L.« (beim Vorlesen dachte ich, ihr Name sei Elle). Sie tritt etwa in Erscheinung, wenn es um ihr Lieblingsshampoo geht, das noch immer im Bad des Protagonisten steht oder wenn er sich – um sich zu »bestrafen«, wie er es nennt – täglich mit Tiefkühlpizza versorgt.
Wenn die Studierenden Fragen stellen, die sich mit der Intention des Autors befassen und erklärt haben wollen, warum diese Stelle so aussieht, in jenem Kapitel diese Wörter erscheinen, dann scheint eine gewisse Selbstironie in Wagners Antworten durch. Er stellt fest, dass er »die Literaturwissenschaft beiseite lassen« müsse, weil er sonst keinen Roman schreiben könne. Außerdem sei das Buch ja schon 2009 erschienen und weit davor entstanden (in dieser Zeit sind die »Charaktere zu ihm gekommen«), weshalb es ihm vorkomme, »aus einem fast fremden Buch zu lesen«. Zu einer Aussage bezüglich seiner Intention lässt sich der Gast schließlich doch hinreißen, wenn er sagt, dass er einen Supermarkt »nachbauen« wollte: die Kapitel sollten den Fluss der fließenden Regale abbilden, weshalb das Buch weitestgehend absatzfrei ist. Allerdings müsse man in einem Supermarkt ja auch gelegentlich um die Ecke biegen, sodass auch im Buch kurze Unterbrechungen dieser Linearität in Ordnung seien. Vielleicht ist das aber auch eine retrospektive Interpretation eines Literaturwissenschaftlers, der sich mit seinem eigenen Autor-Sein auseinandersetzt und fragt: »Wie kommt es eigentlich, dass ein Buch dann so aussieht?«